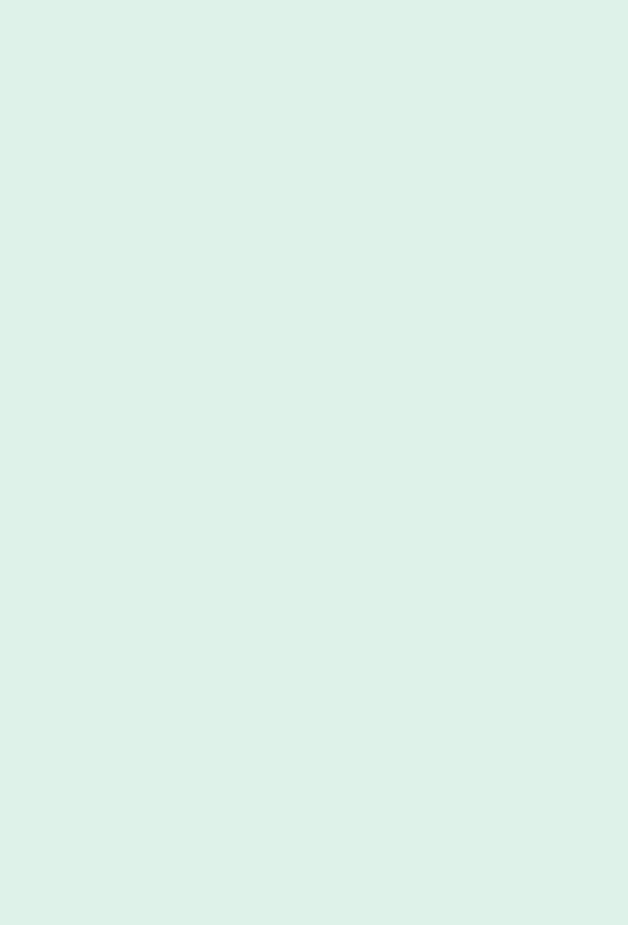Abteilung für Geriatrie
Fachabteilung für Altersmedizin und Rehabilitation
Die Fachabteilung für Altersmedizin und Rehabilitation deckt das gesamte Spektrum der Geriatrie ab. Dazu gehören die Akutgeriatrie, die Alterstraumatologie sowie die Geriatrische Rehabilitation in stationärer, ambulanter (mit Tagesklinik) und in der mobilen Form, bei der unsere Fachkräfte zu den Patientinnen und Patienten nach Hause kommen.
In einer besonders geschützten und sensibel gestalteten Atmosphäre – auch für kognitiv eingeschränkte Personen – versorgen wir in der Akutgeriatrie ältere Menschen medizinisch und pflegerisch mit einem vielfältigen Therapieangebot.
Zusammen mit der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie bilden wir das zertifizierte Zentrum für Alterstraumatologie am Robert Bosch Krankenhaus. Gemeinsam behandeln und beraten wir hier ältere Menschen mit neu aufgetretenen Knochenbrüchen.
In unserer Klinik für Geriatrische Rehabilitation setzen wir alles daran, unsere Patientinnen und Patienten individuell so zu stärken und zu unterstützen, dass sie ihren Alltag wieder so selbstständig wie möglich gestalten können. In unserem geriatrischen Team arbeiten dafür Disziplinen wie Medizin, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Pflege und Sozialdienst Hand in Hand.
Unsere Abteilung betreibt zudem viele Forschungsprojekte mit nationaler und internationaler Ausstrahlungskraft und legt einen großen Wert auf Translation – der schnellen Übertragung von der Forschung in den Alltag.
Bei uns steht die ganzheitliche Versorgung von älteren, multimorbiden Menschen im Mittelpunkt. Dazu arbeiten wir interdisziplinär mit allen Expert:innen des Robert Bosch Krankenhauses zusammen.
Schwerpunkte der Abteilung für Geriatrie
Stationäre Geriatrische Rehabilitation
Ambulante Geriatrische Rehabilitation (Tagesklinik)
- Mobile Geriatrische Rehabilitation
- Akutgeriatrie
- Alterstraumatologie
Kontakt zur Abteilung für Geriatrie
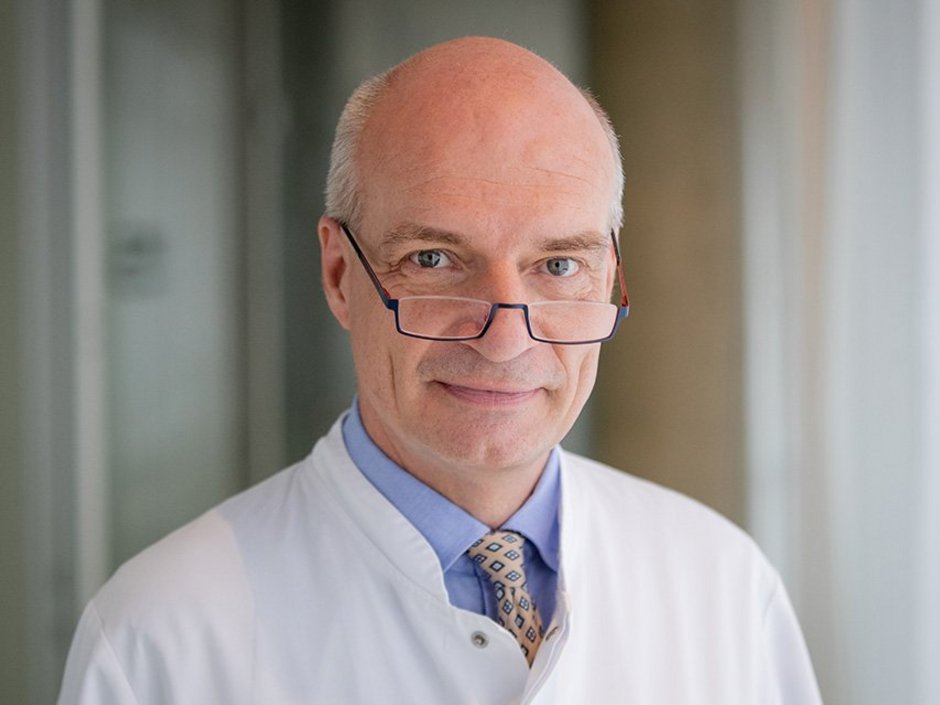
Chefarzt
Prof. Dr. med.
Markus Ketteler
Sekretariat Klinik für Geriatrische Rehabilitation
Daniela Hoffmann, Katharina Giebler
Telefon 0711 8101-3101
Telefax 0711 8101-3199
reha@rbk.de
Sekretariat Akutgeriatrie
Yvonne Köpf
Telefon 0711 8101-6319
Telefax 0711 8101-6562
sekretariat-innere-city@rbk.de

Ärztlicher Leiter
Prof. Dr. med.
Kilian Rapp
Telefon 0711 8101-3101
Telefax 0711 8101-3199
kilian.rapp@rbk.de
Leiter Forschungsabteilung Geriatrie
Lernen Sie das Team der Abteilung für Geriatrie kennen.
Ihr Kontakt zu unseren Pflegestationen
Station 3A am Robert Bosch Krankenhaus, Standort City
Kontakt
Telefon 0711 8101-6320
3A-city@rbk.de
Stationsleiterin: Sonja Fuhrmann
So finden Sie uns
Die Station 3A befindet sich im Robert Bosch Krankenhaus, Standort City (Hohenheimer Straße 21, 70184 Stuttgart) im 3. OG.
Station 4A am Robert Bosch Krankenhaus, Standort City
Kontakt
Telefon 0711 8101-6330
4A-city@rbk.de
Stationsleiterin: Mareike Schlotz
So finden Sie uns
Die Station 4A befindet sich im Robert Bosch Krankenhaus, Standort City (Hohenheimer Straße 21, 70184 Stuttgart) im 4. OG.
Station 4B am Robert Bosch Krankenhaus, Standort City
Kontakt
Telefon 0711 8101-6340
4B-city@rbk.de
Stationsleiterin: Mareike Schlotz
So finden Sie uns
Die Station 4B befindet sich im Robert Bosch Krankenhaus, Standort City (Hohenheimer Straße 21, 70184 Stuttgart) im 4. OG.
Station 5A am Robert Bosch Krankenhaus, Standort City (Wahlleistungsstation)
Kontakt
Telefon 0711 8101-6350
5A-city@rbk.de
Stationsleiterinnen: Annegret Binder, Ursula Winkler
So finden Sie uns
Die Station 5A befindet sich im Robert Bosch Krankenhaus, Standort City (Hohenheimer Straße 21, 70184 Stuttgart) im 5. OG.
Station 5B am Robert Bosch Krankenhaus, Standort City
Kontakt
Telefon 0711 8101-6360
5B-city@rbk.de
Stationsleiterinnen: Annegret Binder, Ursula Winkler
So finden Sie uns
Die Station 5B befindet sich im Robert Bosch Krankenhaus, Standort City (Hohenheimer Straße 21, 70184 Stuttgart) im 5. OG.
Station 6A am Robert Bosch Krankenhaus, Standort City
Kontakt
Telefon 0711 8101-6370
6A-city@rbk.de
Stationsleiterin: Karin Erhardt
So finden Sie uns
Die Station 6A befindet sich im Robert Bosch Krankenhaus, Standort City (Hohenheimer Straße 21, 70184 Stuttgart) im 6. OG.
Station 6B am Robert Bosch Krankenhaus, Standort City
Kontakt
Telefon 0711 8101-6380
6B-city@rbk.de
Stationsleiterin: Karin Erhardt
So finden Sie uns
Die Station 6B befindet sich im Robert Bosch Krankenhaus, Standort City (Hohenheimer Straße 21, 70184 Stuttgart) im 6. OG.
Besucherinformation
Unsere Besuchszeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr.
Auf unseren Überwachungs- und Intensivstationen gelten gesonderte Besuchszeiten, diese erfahren Sie beim Stationspersonal.
Zusammenarbeit für bestmögliche Behandlung
Ältere Menschen leiden häufig unter mehreren behandlungsbedürftigen Erkrankungen. Die Therapie von multimorbiden Patient:innen ist daher besonders herausfordernd. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Expert:innen unterschiedlicher medizinischer Fachabteilungen ist dann für eine gute Behandlung wichtig.
Das Zentrum für Alterstraumataologie des Robert Bosch Krankenhauses ist spezialisiert auf die fachübergreifende unfallchirurgisch-geriatrische Versorgung älterer Menschen mit Unfallverletzungen.
Am Robert Bosch Krankenhaus erfolgt die Behandlung von Schlaganfallpatient:innen interdisziplinär im Team auf einer speziell dafür ausgerichteten internistischen Überwachungsstation.
651
in der Geriatrischen Rehabilitation
in 2022
93 %
Bettenauslastung

Pflege und Betreuung
in der Abteilung für Geriatrie
Unsere Pflegeteams, Therapeut:innen und weitere unterstützende Dienste geben mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung täglich ihr Bestes für Ihre Gesundheit und Genesung.

Qualität und Patientensicherheit
in der Abteilung für Geriatrie
Unser Anspruch ist es, jede Patientin und jeden Patienten von Beginn an mit höchster Qualität und so sicher wie möglich zu versorgen.

Forschung und klinische Studien
in der Abteilung für Geriatrie
Das Robert Bosch Krankenhaus ist als Teil des Bosch Health Campus eng mit der Forschung verbunden. Neueste Erkenntnisse kommen Ihnen so direkt zu Gute. Auch ist die Teilnahme an einer klinischen Studie für viele Patient:innen eine Option – insbesondere wenn es keine guten Behandlungsmöglichkeiten gibt.
Karriere und Bildung

Ihre Karriere am RBK
Über 3.000 Mitarbeitende schätzen das Robert Bosch Krankenhaus als modernen Arbeitgeber. Werden auch Sie Teil unseres Teams.

Ihre berufliche Bildung
Das Irmgard Bosch Bildungszentrum bietet ein qualifiziertes Programm an Fort- und Weiterbildungen für Ihren beruflichen Erfolg.