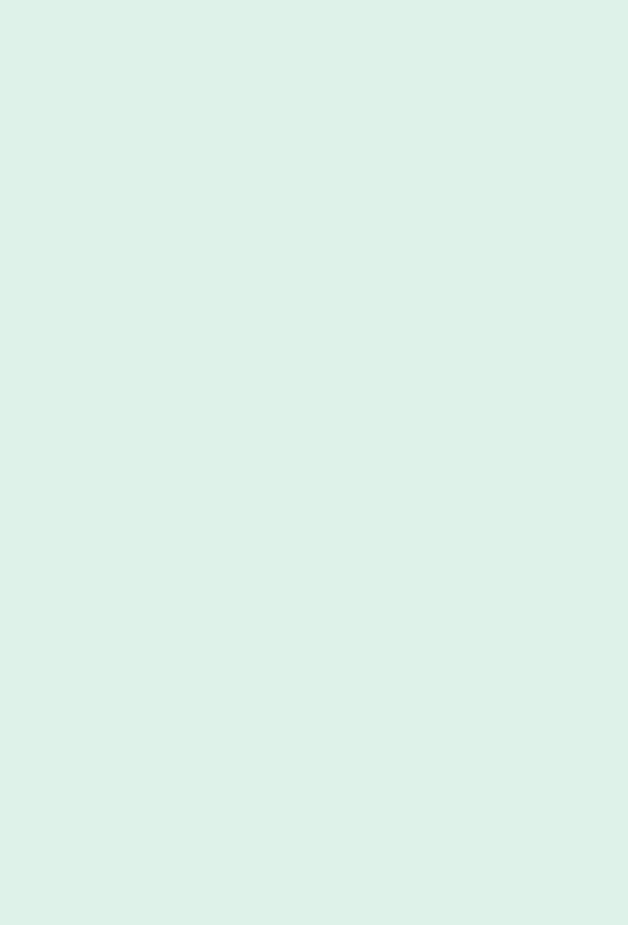Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin
Fachabteilung für Bildgebende Diagnostik und Diagnostik und Therapie mittels radioaktiver Substanzen
Unsere Fachabteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie sowie Nuklearmedizin arbeitet in zentraler Funktion sehr eng mit allen Fachbereichen am Robert Bosch Krankenhaus interdisziplinär zusammen. Mit einer hochinnovativen apparativen Ausstattung bieten wir exzellente fachliche Kompetenz sämtlicher bildgebender Verfahren wie klassische Röntgenaufnahmen, Computertomografie, Magnetresonanztomografie und Mammografie sowie das gesamte Spektrum der Sonografie und nuklearmedizinischer Methoden in Diagnostik und Therapie auf höchstem Niveau.
Neben den Bild-basierten Verfahren zur Diagnostik verschiedenster Erkrankungen nimmt die moderne Radiologie mit ihren hochpräzisen Bild-gesteuerten Verfahren eine immer bedeutendere Rolle im Bereich der minimalinvasiven Behandlungsmöglichkeiten ein. So sind beispielsweise kleine bösartige Tumore sehr schonend – ohne die Notwendigkeit für eine große offene Operation – mit einer feinen Nadel oder Katheter durch die Haut bzw. das Blutgefäßsystem erfolgreich behandelbar.
Sprechen Sie uns gerne an. Auch im Rahmen einer Zweitmeinung oder bei bereits anderweitig durchgeführten Behandlungen stehen wir gerne zur Verfügung.
Schwerpunkte und Krankheitsbilder
Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin
- Computertomografie (CT)
- Magnetresonanztomografie (MRT, Kernspintomografie)
- Interventionelle Radiologie
- Nuklearmedizin, Szintigrafie
- Angiografie und interventionelle Gefäßtherapien
Weitere Schwerpunkte und Krankheitsbilder im Überblick
Kontakt
zur Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin

Chefarzt
Prof. Dr. med.
Alexander Maßmann
Sekretariat
Ariane Henker
Telefon 0711 8101-3436
Telefax 0711 8101-3776
ariane.henker@rbk.de
Lernen Sie das Team der Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin kennen.
Terminvereinbarung für Untersuchungen, Ambulanzen und Zweitmeinung
Montag – Freitag
nach Vereinbarung
Terminvereinbarung
Telefon 0711 8101-3437
termine.radiologie@rbk.de
Ort
Robert Bosch Krankenhaus, Auerbachstraße 110, 70376 Stuttgart,
Radiologie und Nuklearmedizin, Hauptgebäude, Erdgeschoss
Montag – Freitag
nach Vereinbarung
Terminvereinbarung
Telefon 0711 8101-3376
nuklearmedizin@rbk.de
Ort
Robert Bosch Krankenhaus, Auerbachstraße 110, 70376 Stuttgart,
Radiologie und Nuklearmedizin, Hauptgebäude, Erdgeschoss
Es besteht ein gesetzlich verankerter Anspruch von Patientinnen und Patienten auf eine Zweitmeinung zu Diagnose und Therapievorhaben.
Sollten Sie Unsicherheit oder ergänzende Information zu Fragen medizinischer Diagnostik aus dem Bereich Bildgebender Verfahren aller Organsysteme wie bspw. Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT) haben, stehen wir gerne zu einer Durchsicht und fundierten Zweitbefundung zur Verfügung.
Ebenso können wir Sie zu allen bildgesteuerten minimalinvasiven perkutanen interventionellen Behandlungsverfahren beraten. Dies inkludiert sämtliche vaskuläre gefäßeröffnende Verfahren von Gefäßverengungen – zum Beispiel periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Angina abdominalis, Nierenarterienstenose oder Beckenvenenthrombose sowie Hämodialyse-Shunt und der Shunt-Anlage.
Des weiteren gefäßverschließende Maßnahmen wie Aneurysmen von viszeralen Arterien (Milzarterienaneurysma) und die Endoprothetik der Aorta thoracalis und abdominalis (Aortenstent bei Bauchaortenaneurysma), Embolisationsverfahren der Prostata, Gebärmutter, Krampfadern der Vena spermatica (Varicocele) und Beckenvenensyndrom (pelvic congestion) sowie spezieller Gefäßmissbildungen (Gefäßmalformation). Es besteht eine weitreichende onkologische Expertise zu lokal ablativen Verfahren, beispielsweise der fokalen Therapie von Lungenkrebs, Leberkrebs, Nierenkrebs und Metastasen in örtlicher Betäubung.
Gerne prüfen wir Ihren medizinischen Sachverhalt auch im Vorfeld etwaiger juristischer Fragen und beraten Sie in unserer Ärztlichen Zweitmeinungs-Sprechstunde.
Bitte lassen Sie uns dazu mit Ihrer Kontaktaufnahme sämtliche zur Fragestellung relevanten Unterlagen und Befunde, insbesondere radiologisches Bildmaterial aktueller und älterer CT- bzw. MRT-Untersuchungen zukommen.
Ihr Kontakt zu unserer Pflegestation
Besucherinformation
Unsere Besuchszeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr.
Auf unseren Überwachungs- und Intensivstationen gelten gesonderte Besuchszeiten, diese erfahren Sie beim Stationspersonal.
Station 1LN
Kontakt
Telefon 0711 8101-4066
Stationsleiterin: Simone Held
So finden Sie uns
Die Station 1LN befindet sich im 1. OG des Hauptgebäudes.
Zusammenarbeit für bestmögliche Behandlung
Bei manchen Erkrankungen ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Expert:innen verschiedener Fachabteilungen besonders wichtig. Gemeinsam im Team wird eine auf die individuelle Situation der Betroffenen abgestimmte Therapie entwickelt.
Radiologische Verfahren sind für Diagnostik und Therapie unverzichtbar. Daher sind wir eng mit allen Abteilungen des Robert Bosch Krankenhauses verbunden und unterstützen mit zahlreichen bildgebenden Verfahren und Interventionen.
Wir sind Partner im Onkologischen Zentrum des Robert Bosch Krankenhauses, dem Robert Bosch Centrum für Tumorerkrankungen (RBCT). Das Robert Bosch Centrum für Tumorerkrankungen vereint onkologische Diagnostik und Behandlung sowie Krebsforschung am Bosch Health Campus.
Das RBCT bündelt gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Tübingen seine Expertise im Onkologischen Spitzenzentrum Comprehensive Cancer Center (CCC) Tübingen-Stuttgart. Mit den Onkologischen Spitzenzentren (CCC) sollen alle an Krebs Erkrankten eine noch bessere, individuell zugeschnittene Behandlung nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft erhalten.
Die Onkologischen Spitzenzentren Tübingen-Stuttgart (CCC-TS) und Ulm (CCCU) schließen wiederum ihre Behandlungsexpertise und Forschungsinfrastruktur im gemeinsamen Standort „NCT-SüdWest“ des erweiterten Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) zusammen. Anspruch ist, neue Entwicklungen aus den Forschungseinrichtungen noch schneller und unter höchsten Ansprüchen klinisch zu testen, um hierdurch Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für Patient:innen weiter zu verbessern.
Jede achte Frau erkrankt im ihrem Leben an Brustkrebs – rechtzeitig erkannt, ist die Erkrankung aber heilbar. Unsere Expertise haben wir fachübergreifend im Brustzentrum des Robert Bosch Krankenhauses für die bestmögliche Diagnostik und Therapie gebündelt.
Spezielle OP-Techniken ermöglichen uns schonende Eingriffe bei Patientinnen mit Tumoren an den weiblichen Geschlechtsorganen. Unsere interdisziplinären Partner im Zentrum ergänzen die Therapie individuell für jede Frau.
Darmkrebs zählt zu den häufigsten Krebsarten in Deutschland. Neben den beteiligten Fachdisziplinen des Robert Bosch Krankenhauses sind Kollegen im niedergelassenen Bereich als externe Kooperationspartner in das Netzwerk miteingebunden.
Eine Operation des Bauchspeicheldrüsenkrebses ist nur ein Baustein in der komplexen Therapie, welche wir in unserem zertifizierten Zentrum anbieten.
In diesem interdisziplinären Zentrum behandeln wir fachübergreifend Patient:innen mit Krebserkrankungen der Speiseröhre, des Magens und der Leber.
Ausgewiesene Spezialist:innen aus Pneumologie, Thoraxchirurgie, Strahlentherapie, Radiologie, Nuklearmedizin, Onkologie und Pathologie arbeiten fachübergreifend erfolgreich im Lungenkrebszentrum zusammen.
Das Mesotheliom, eine seltene Tumorerkrankung, häufig verursacht durch Kontakt mit Asbest, ist in Diagnostik und Behandlung komplex und stellt für die behandelnden Ärzt:innen eine Herausforderung dar. Betroffene werden daher im RBK Lungenzentrum Stuttgart am Robert Bosch Krankenhaus fachübergreifend in einer Mesotheliomeinheit, zertifiziert durch die Deutsche Krebsgesellschaft, nach festgelegten Standards und neuesten Studienergebnissen behandelt. Eine Spezialsprechstunde ist etabliert.
Für das frühzeitige Erkennen und die optimale Behandlung einer Bluterkrankung arbeiten in unserem Zentrum für Hämatologische Neoplasien wie Leukämien, Lymphome (Lymphdrüsenkrebs) oder Knochenmarkerkrankungen unterschiedliche Fachbereiche Hand in Hand.
Aufgrund der Tatsache, dass jede anatomische Körperregion von Tumoren des Weichgewebes betroffen sein kann, ist zur optimalen Diagnostik und Therapie von Sarkomen eine gemeinsame Vorgehensweise mehrerer medizinischer Fachrichtungen notwendig.
Das Robert Bosch Krankenhaus ist als regionales Traumazentrum auf die Behandlung von Schwerverletzten spezialisiert und von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) zertifiziert. Bei der Erstversorgung arbeiten Expert:innen der Unfallchirurgie, Anästhesie und Notfallmedizin sowie Radiologie eng zusammen, weitere Fachbereiche wie Viszeral- oder Neurochirurgie können jederzeit 24/7 hinzugezogen werden.
Das Zentrum für Alterstraumataologie des Robert Bosch Krankenhauses ist spezialisiert auf die fachübergreifende unfallchirurgisch-geriatrische Versorgung älterer Menschen mit Unfallverletzungen.
Chronische Darmerkrankungen zeigen unterschiedliche Ausprägungen und bedürfen daher einer abteilungsübergreifenden Behandlung.
Am Robert Bosch Krankenhaus erfolgt die Behandlung von Schlaganfallpatient:innen interdisziplinär im Team auf einer speziell dafür ausgerichteten internistischen Überwachungsstation.
Krankheitsbilder der Interstitiellen Lungenerkrankungen sind vielfältig und komplex. Um für Betroffene die bestmögliche Diagnostik und Therapiemöglichkeit abstimmen zu können, ist am Robert Bosch Krankenhaus ein ILD-Board etabliert.
49.754
≈ 320
536

Qualität und Patientensicherheit
in der Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin
Unser Anspruch ist es, jede Patientin und jeden Patienten von Beginn an mit höchster Qualität und so sicher wie möglich zu versorgen.

Forschung und klinische Studien
in der Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin
Das Robert Bosch Krankenhaus ist als Teil des Bosch Health Campus eng mit der Forschung verbunden. Neueste Erkenntnisse kommen Ihnen so direkt zu Gute. Auch ist die Teilnahme an einer klinischen Studie für viele Patient:innen eine Option – insbesondere wenn es keine guten Behandlungsmöglichkeiten gibt.
Karriere und Bildung

Ihre Karriere am RBK
Über 3.000 Mitarbeitende schätzen das Robert Bosch Krankenhaus als modernen Arbeitgeber. Werden auch Sie Teil unseres Teams.

Ihre berufliche Bildung
Das Irmgard Bosch Bildungszentrum bietet ein qualifiziertes Programm an Fort- und Weiterbildungen für Ihren beruflichen Erfolg.